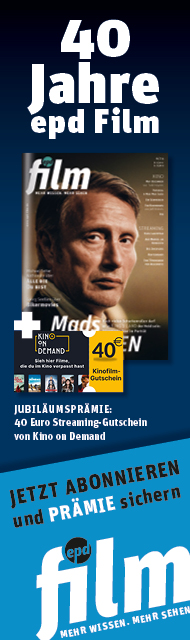Maxi Braun
Filmkritiken von Maxi Braun
Was als melancholische Charakterstudie beginnt und Potential für eine kolonialismuskritische Betrachtung einer ungleichen Liebe offenbart, fällt narrativ auseinander und reproduziert letztlich Klischees über weibliches Begehren jenseits der 40.
Mit konzentrierterem Fokus auf narrative und bildgestalterische Aspekte hätte Gerwig mit »Barbie« ein feministischer Paukenschlag gelingen können. Stattdessen zündet sie ein durchweg unterhaltsames, pink-glitzerndes Knallbonbon mit Ryan Gosling als heimlichem Helden.
Mit kleinem Team gedreht, konzentriert sich der Film ausschließlich auf die Betroffenen selbst, wodurch ein respektvoller Einblick in das Thema psychische Erkrankungen gelingt, das zwar in den letzten Jahren enttabuisiert wurde, aber noch immer gesellschaftlich stigmatisiert ist.
Das dokumentarische Langfilmdebüt von Max Eriksson über den ehemaligen Skaterprofi Ali Boulala und den Unfall, der 2007 dessen Karriere und fast auch dessen Leben beendete, porträtiert mit Archivmaterial und Interviews die wilde Szene von Profiskatern in den 1990er und 2000er Jahren wie einen wilden Sog.
Saskia Diesing erzählt mit überzeugenden Protagonistinnen von unerwarteter feministischer Solidarität am Ende des Zweiten Weltkrieges und kreiert so eine neue Art von Antikriegsfilm.
Emily Atef adaptiert Daniela Kriens Debütroman über eine tragische Liebe in der Zeit zwischen Wende und Wiedervereinigung in Ostdeutschland als stimmungsvolle, aber nicht unproblematische Amour Fou, bei der die inneren Beweggründe der Figuren mysteriös bleiben.
In dem einfühlsamen Dokumentarfilm über ihre Mutter Lore und das Verhältnis zu ihr macht sich Kim Seligsohn verletzlich und zeigt eindrucksvoll auf, wie sehr sich Traumata von Flucht, Vertreibung und Verlust über mehrere Generationen hinweg in die Körper und Psychen derjenigen einschreiben, die überlebt haben.
Maryam Touzani gelingt ein formvollendeter Film, der seine Figuren behutsam inszeniert und sie auch in Momenten größter Verletzlichkeit strahlen lässt. Nebenbei greift sie furchtlos und doch respektvoll Tabuthemen wie Homosexualität und Tod auf und zeigt eine andere Seite der marokkanischen Gesellschaft.
Was vorweihnachtlicher Sozialkitsch hätte werden können, entpuppt sich zu einer angenehm realistischen Geschichte zweier starker Mädchen und ihrer diversen Peergroup mit besinnlichem Flair vor der winterlichen Kulisse einer isländischen Stadt.
Bildsprachlich berauschend und in Neonfarben getränkt bleibt die Dystopie eines brasilianischen Gottestaats inhaltlich etwas vage. Die feministische Emanzipationsgeschichte ist dabei narrativ ebenso offen wie der namensgebende Mythos.